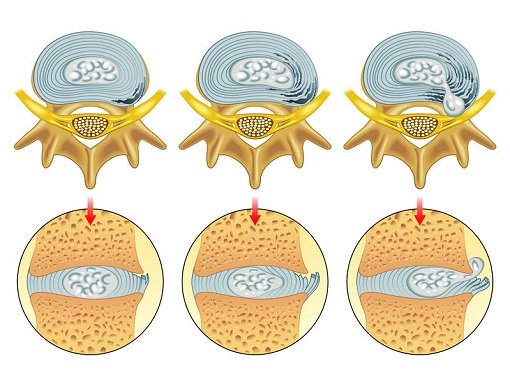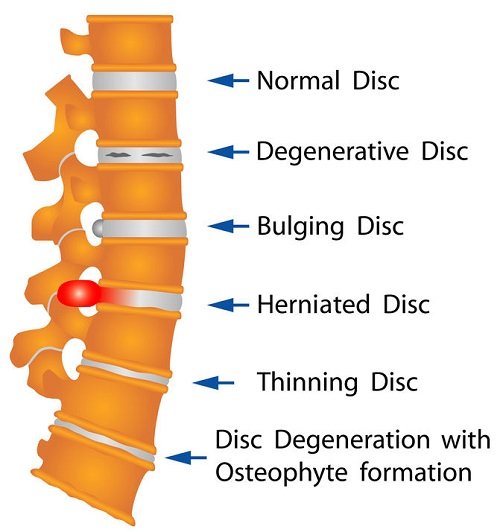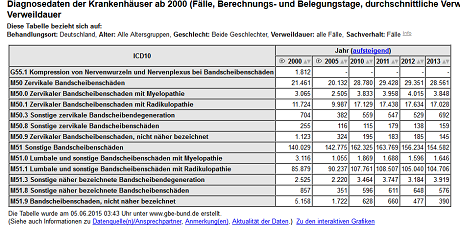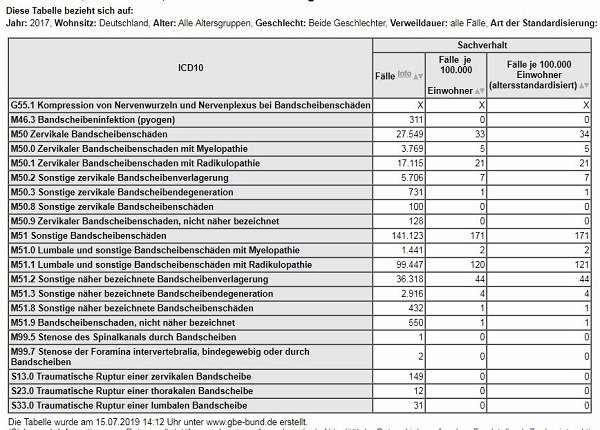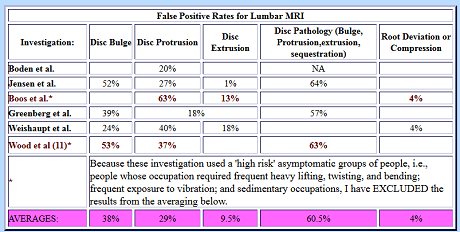Psychoneuroimmunologie – Wie ihr Gehirn und ihr Immunsystem zusammenarbeiten
Die Psychoneuroimmunologie ist eine Wissenschaft, die 1975 vom dem Psychologen Robert Ader und dem Immunologen Nicholas Cohen aus der Taufe gehoben wurde. Das Experiment dazu war ein klassischer Konditionierungsversuch an Ratten.
Die beiden Wissenschaftler nahmen mit Saccharin gesüßtes Wasser und injizierten gleichzeitig das Zytostatikum Cyclophosphamid, das bei den Tieren unweigerlich Übelkeit und Geschmacksveränderung auslöst und die Immunabwehr beeinträchtigt. Nachdem die Tiere eine Weile dieses Wassergemisch, begleitet von den Injektionen, hatten zu sich nehmen müssen, gaben die Wissenschaftler nur noch das gesüßte Wasser ohne die zusätzlichen Injektionen.
Sie waren überrascht, als sie sahen, dass einige Ratten danach starben, obwohl das Zytostatikum fehlte. Daher vermuteten sie, dass die Ratten an einer psychologisch bedingten Immunschwäche starben, ausgelöst durch den Verzehr von Saccharin-Wasser. In der Folge untersuchten sie diese Hypothese und konnten nachweisen, dass neuropsychologische Faktoren in der Tat zu einer Beeinträchtigung des Immunsystems bei konditionierten Tieren führte.
Mit anderen Worten: Das Signal, das über das Nervensystem, in diesem Fall der Geschmack, dem Gehirn zugeführt wird, hat auch im Nachhinein einen nachhaltigen Effekt auf das Immunsystem, wenn es zuvor von negativen physiologischen Ereignissen (Zytostatikum-Injektion) begleitet wurde. Diese Ergebnisse wurden in der Folge von anderen Wissenschaftlern reproduziert, so dass das Ergebnis von Ader und Cohen nicht mehr als Zufallsergebnis einzustufen ist. Und das war die Geburtsstunde der Psychoneuroimmunologie.
Wie Gehirn und Immunsystem vernetzt sind
Es gibt die Auffassung und inzwischen auch eine Reihe von Hinweise für deren Richtigkeit, dass eine positive, optimistische Einstellung die Grundlage für ein längeres und gesünderes Leben ist. Oder anders herum: Eine negative, pessimistische Einstellung kann lebensverkürzend wirken und/ oder Krankheiten fördern.
Und es gibt Studien dazu: Optimists vs pessimists: survival rate among medical patients over a 30-year period. Diese Studie wurde an der Mayo Klinik im Jahr 2000 mit 839 Patienten durchgeführt. Sie kam zu dem Schluss, dass eine pessimistische Grundhaltung mit einer signifikant erhöhten Mortalität verbunden ist. Natürlich wurde in dieser Studie keine Aussage gemacht, worauf dieser Mechanismus beruht.
In den 1960er Jahren gab es einen Journalisten, der als der Begründer der „Lachtherapie“ gilt, Norman Cousins. Sein Arzt stellte 1964 bei ihm eine chronische Entzündung der Wirbelsäule fest, die sich Jahre später als „Morbus Bechterew“ manifestierte. Man erklärte ihm, dass seine Chancen zur Heilung bei 1 zu 500 lagen. Darauf hin kreierte Cousins sein eigenes Programm zur Lachtherapie.
Der Erfolg sollte ihm Recht geben: Er starb im November 1990 und lebte damit länger als seine Ärzte ihm prophezeit hatten – 26 Jahre nach der Diagnose der chronischen Entzündung und 36 Jahre nach einer ersten Diagnose einer Herzerkrankung (die möglicherweise mit der späteren Diagnose in Zusammenhang gestanden hat).
Es begannen vermehrt Forschungen auf diesem Gebiet, die in den 1980er und 1990er Jahren ihren erste Höhepunkt fanden. Man fand zu diesem Zeitpunkt heraus, dass das Gehirn und das Immunsystem eine direkte Verbindung haben, und dass es Verbindungen gibt zwischen dem Nervensystem und den immunologisch wichtigen Organen, wie Thymus und Knochenmark. Diese Verbindungen erlauben einen kreuzweisen Austausch von „Informationen“ untereinander.
Damit hatten die Wissenschaftler entdecken können, dass die Immunzellen ebenfalls Rezeptoren für Neurotransmitter haben. Und damit wird verständlich, dass Vorgänge im Gehirn auf die Immunzellen übertragen werden können beziehungsweise einen Einfluss auf die Tätigkeit der Immunzellen haben.
Bis zu diesem Zeitpunkt hat es Erklärungen gegeben, warum Stress und Infektionsanfälligkeit Hand in Hand zu gehen scheinen, die nur über einen indirekten Mechanismus laufen – aber auch eine valide Erklärung sind: Dauerstress bewirkt die Ausschüttung von Stresshormonen, zu denen die Glucocorticoide gehören. Und Glucocorticoide haben eine potente immunsuppressive Wirkung, weshalb sie in der Medizin bei der Behandlung von Allergien und Autoimmunerkrankungen zum Einsatz kommen.
Ein so zusammengestauchtes Immunsystem kann nicht mehr adäquat auf eine Infektion reagieren. Daher ist die Beseitigung von Dauerstress eine besonders wichtige Voraussetzung für eine geringere Infektionsanfälligkeit.
Stress erhöht zudem die Konzentrationen von Antikörpern gegen häufig auftretende Viren, wie Epstein-Barr-Virus. Dadurch kann es zu einer Aktivierung eines ansonsten latent vorhandenen Virus kommen. Weiter wissen wir inzwischen, dass Dauerstress die Konzentrationen an C-reaktivem Protein erhöht, was den Entzündungsstatus verschlechtert beziehungsweise den Grad der Entzündungsprozesse erhöht.
Die Macht der positiven Gedanken und Einstellungen
Positive Gedanken und Gefühle haben somit einen beträchtlichen Einfluss auf die eigene Gesundheit. Dr. Steve Cole vom Cousins Center für Psychoneuroimmunologie, einem Institut, das von Cousins gegründet worden ist, hat eine Reihe von Studien durchgeführt, die die genetischen Effekte von verschiedenen mentalen Zuständen untersuchten: Social regulation of gene expression in human leukocytes.
In dieser Arbeit fanden er und seine Kollegen, dass lang anhaltendes Alleinsein die Gene einschaltet, die an der Auslösung von Entzündungsprozessen beteiligt sind. Auf der anderen Seite werden die Gene gedämpft, die für die Bekämpfung von viralen Infektionen zuständig sind. Beides zusammen genommen resultiert in einer „saftigen Immunschwäche“.
Eine Arbeit von 2012 (The heart’s content: the association between positive psychological well-being and cardiovascular health.) konnte zeigen, dass Glücklichsein, Optimismus, Zufriedenheit und andere positive psychologische Eigenschaften signifikant zu einem geringeren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen beitragen.
Bei dieser „Kategorie“ von Menschen findet eine entgegengesetzte Aktivierung beziehungsweise Deaktivierung der entsprechenden Gene statt, so dass das Immunsystem zu einer besseren Funktion fähig ist. In einer von Prof. Coles „Glückseligkeitsstudien“ beantworteten die Teilnehmer Fragen zu der Häufigkeit bestimmter emotionaler Zustände.
Es handelt sich hier um im Wesentlichen zwei Typen von Glücklichsein: A. Hedonisches Vergnügen, ein sich glücklich Fühlen durch angenehme Erfahrungen; B. Eudaimonistisches Vergnügen (nach Aristoteles), bei dem das Glück durch Aktivitäten erzeugt wird, die auf Lebensfragen, Selbsterfahrung, Sinnfragen des Lebens abzielen.
Hier kommt es zu einem mehr als interessanten Unterschied. Beide Typen vermitteln Glücksempfinden. Aber sie resultieren nicht in der gleichen genetischen Antwort. Denn die Auswertung der Genaktivitäten zeigte, dass eudaimonistisch begründetes Vergnügen zu einer vorteilhaften Genkonstellation führte. Die hedonistische Variante dagegen zeigte mehr ein Profil, dass dem vorhin diskutierten Stressprofil gleicht.
Oder mit kurzen, nüchternen Worten: Selbsterfahrung etc. und die daraus resultierende Erkenntnis und Glücksgefühl sind gesund, Shoppen, turbulentes Nachtleben und Halli-galli Lifestyle und der Jagd nach immer mehr Glücksmomenten ist für den Organismus gleichbedeutend mit Stress.
Die Hypothese für diese Unterschiede, so Prof. Cole, sieht folgendermaßen aus: Die Jagd nach materiellen Werten macht das Glücksgefühl von Umständen abhängig, die sehr oft nicht beeinflussbar sind. Bekommt man nicht, was man will, dann steht der Betroffene in einer „glänzenden“ Stresssituation – er ist frustriert. Auf der anderen Seite ist die „Jagd“ nach dem Sinn des Lebens, der Selbsterkenntnis etc. kaum von externen Umständen abhängig.
Und der sich einstellende Erfolg und das daraus resultierende Glücksgefühl sind nicht flüchtig, bedürfen keiner Erneuerung und können einem nicht weggenommen werden.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Während wir gesehen haben, dass Glück nicht gleich Glück sein muss und unterschiedliche psychoneuroimmunologische Effekte mit sich bringt, gibt es auch verschiedene Arten von Stress, die nicht alle unweigerlich zu unvorteilhaften Genaktivitäten führen müssen (Psychoneuroimmunology: laugh and be well).
Kurzer Stress, wie zum Beispiel den Stress, den man haben kann, wenn man eine Rede vor einem versammelten Saal halten soll, unterdrückt die Zellimmunität, also jenen Bereich des Immunsystems, der dem erworbenen Immunsystem angehört und bei der Infektionsbekämpfung beteiligt ist. Die humorale Seite des Immunsystems, die für die Produktion der Antikörper zuständig ist und die damit verbundenen Prozesse steuert, bleiben von diesem Stress unbeeinflusst. Daher könnte es sein, dass die Empfindlichkeit für Erkältungen oder Grippe erhöht ist.
Chronischer Stress dagegen unterdrückt beide Komponenten des Immunsystems. Daher wird der Betroffene nicht nur leichter empfänglich für Infektionen, sondern im Wesentlichen für alle Erkrankungen, bei denen das Immunsystem eine präventive Rolle spielt. Damit ist fast mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass chronischer Stress auch die Entstehung von Krebserkrankungen begünstigt.
Die zuletzt erwähnte Quelle, Medical News Today, bringt eine Reihe von Beispielen, wo Studien bestimmte Zusammenhänge zwischen der Psychologie und Gesundheit beziehungsweise der Schädigung derselben aufzeigen konnten.
- Plötzlicher Tod eines Familienangehörigen – Die Studienergebnisse sagen, dass während der ersten Woche nach dem Tod des Familienangehörigen die Mortalität auf über das Doppelte der sonst üblichen Todesraten hochschnellt.
- Herz- und kardiovaskuläre Probleme, wie Schlaganfall und Herzinfarkte – Wutausbrüche sind potentiell gefährlich, da sie eine massive Freisetzung von Stresshormonen mit sich bringen und für Schäden an den Blutgefäßen sorgen.
Es gibt dazu Erkenntnisse (Stay calm, or you may calcify your arteries, aus: USAtoday.com), die besagen, dass Menschen über 50, die zu Wutausbrüchen neigen, eine erhöhte Ablagerung von Kalzium in den Arterien aufweisen. Und dies ist mit einiger Wahrscheinlichkeit verbunden mit einem erhöhten Risiko für Herzinfarkte.
Eine Metaanalyse dazu (Outbursts of anger as a trigger of acute cardiovascular events: a systematic review and meta-analysis.) beobachtete eine signifikant erhöhte Wahrscheinlichkeit für Herzinfarkte, Arrhythmien und Schlaganfälle nach Wutausbrüchen bei einem sich stetig erhöhenden Risiko, wenn die Anfälle sich häufen.
- Gastrointestinale Probleme – Chronischer Stress ist verbunden mit einer Reihe von gastrointestinalen Problemen, wie chronisch-entzündliche Darmerkrankungen und Reizdarmsyndrom.
- Krebserkrankungen – Die psychologische Einstellung, ob negative oder positive Grundhaltung zu Fragen des Lebens etc., hat einen entscheidenden Einfluss auf die Fähigkeit, sich von dieser und anderen Krankheiten zu erholen. Zudem ist die Qualität und Verfügbarkeit einer guten psychologischen Betreuung während der Krisenzeit ausschlaggebend für den Heilungsprozess, was seine Bedeutung noch einmal nachhaltig unterstreicht.
- HIV – Erhöhter Stress und der Entzug von Unterstützung seitens der Familienangehörigen ist verbunden mit einem besonders raschen Verfall der Betroffenen.
- Allergien – Hautveränderungen, wie Ekzeme oder Psoriasis, haben eine psychologische Grundlage. Das Gleiche gilt besonders für Asthma. Bei Stress verschlechtert sich bei allen die Erkrankung.
- Wundheilung – Auch hier scheint die psychologische Ausgangslage Einfluss zu nehmen. Patienten mit einem erhöhten Grad an Angstgefühlen und/oder Stress bleiben in der Regel länger im Krankenhaus, haben vermehrt postoperative Komplikationen und werden nach der Entlassung aus dem Krankenhaus deutlich öfter wieder eingeliefert. Patienten mit schwer heilenden Wunden an den unteren Extremitäten, so eine Studie, waren in der Regel Patienten mit einem erhöhten Maß an Depressionen und Angstzuständen.
- Entzündungsprozesse – Stressabbauende Strategien, wie Meditation, Yoga etc., bewirken eine Aktivierung der Gene, die für die Abwehr von Viren und die Reduzierung von entzündungsfördernden Prozessen verantwortlich sind.
Die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse
Diese „Achse“, kurz als HPA-Achse bezeichnet, ist ein System direkter Einflussnahme zwischen den drei genannten Drüsen. Sie wird in der Schulmedizin als Teil des „neuroendokrinen Systems“ bezeichnet. Sogar die Beschreibung in Wikipedia konstatiert, dass diese Achse „Reaktionen auf Stress kontrolliert und viele Prozesse im Körper reguliert, einschließlich Verdauung, Immunsystem, Stimmung und Emotionen, Sexualität, Energiespeicherung und -verwendung.“
Das ist insofern verwunderlich, da in der Vergangenheit niemand dem Gehirn eine Verbindung zum Immunsystem „zutraute“. Man hielt auch immunologische Einflüsse innerhalb des Gehirns bestenfalls für Ausnahmefälle, wie bei Allergien, die das Gehirn anschwellen lassen und ein absoluter Notfall sind. Ein sehr prominentes Opfer einer solchen Allergie (gegen Aspirin) und anschließendem Hirnödem war 1973 der Schauspieler Bruce Lee.
Nach einigen Jahre der Forschung auf dem Gebiet der Psychoneuroimmunologie weiß man, dass die HPA-Achse eine federführende Rolle bei einer durch Stress induzierten Interaktion zwischen Gehirn und Immunsystem spielt. Alle drei Drüsen sezernieren Hormone, die für biologische Abläufe, wie Verdauung, Immunfunktion, Sexualität und Empfinden, wichtig sind.
Eine besondere Rolle scheint hier das Corticotropin-releasing Hormon (CRH) aus der HPA-Achse zu spielen. Es entsteht im Hypothalamus als Antwort auf Stress, Krankheit, körperlicher Belastung, erhöhte Kortisonwerte im Blut und während des Schlaf-Wach-Zyklus. Die höchste Produktion an CRH erfolgt kurz nach dem Aufwachen. Im Verlauf des Tages nehmen Produktion und Aktivität des Hormons langsam ab.
Bei Dauerstress jedoch bleiben die Kortisonspiegel über lange Zeiträume unphysiologisch hoch (siehe weiter oben). Stress, gleich ob akuter oder langfristig anhaltender, bedeutet für den Organismus die Annahme von direkter Gefahr für dessen Integrität. Durch die Freisetzung von Kortison werden gleich eine Reihe von metabolischen Veränderungen bewirkt, um sicherzustellen, dass genug Energie und Energiereserven für die Fight-or-flight-Reaktionen zur Verfügung stehen.
Dazu gehören „Sparmaßnahmen“, die Prozesse abschalten oder zumindest auf Sparflamme herunterfahren, die zur Stressantwort nicht unbedingt nötig sind. Und dazu zählen auch die Vorgänge im Immunsystem. Erfreut sich der Organismus aber eines permanenten Stresses, dann werden auch diese Sparmaßnahmen zur Dauereinrichtung. Für das Immunsystem bedeutet dies, dass es auf Dauer nur noch unbedeutende Funktionen für den Organismus hat und seine eigentlichen Aufgaben nicht mehr erfüllen kann.
In der Schulmedizin nennt man so etwas „Immuninsuffizienz“, benutzt diesen Begriff aber im Zusammenhang mit einer Erkrankung, AIDS. Letztendlich kann jeder aus dieser Sicht gesehen an „AIDS“ leiden, vorausgesetzt sein Immunsystem ist durch Dauerstress nachhaltig ausgebremst.
Als Gegenspieler dieses Systems gibt es ein Hormon, das Oxytocingenannt wird. Dieses Hormon vermittelt soziale Nähe zwischen Mutter und Kind, Mann und Frau, unter Freunden und Verwandten etc. Und es unterdrückt die HPA-Achse, was zu einer „Befreiung“ des Immunsystems führt. Darum sind soziale Kontakte, wie weiter oben beschrieben, so wichtig für eine solide Gesundheit beziehungsweise fehlende Kontakte so schädigend.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Die Sache mit dem Stressabbau
Wie schon häufig betont, ist der Abbau von Stress, besonders von Dauerstress, das zentrale Dauerthema. Meditation, Yoga, Tai-chi, autogenes Training u.v.a.m. gelten als probate Mittel zur Stressreduktion. Auch zu diesem Themenkomplex gibt es bereits Studien: Meditation Eases Pain, Anxiety and Fatigue During Breast Cancer Biopsy.
Wie die Überschrift schon verrät, wurde hier Meditation als ein Mittel eingesetzt, um Schmerzen, Unruhezustände und Fatigue bei Brustkrebspatienten im Rahmen einer Biopsie zu „behandeln“. Insgesamt nahmen 121 Frauen an der Untersuchung teil. Diese Frauen wurden in drei Gruppen per Zufall eingeteilt. Gruppe A meditierte, Gruppe B hörte Musik nach Wahl (Klassisch, Jazz, natürliche Geräusche etc.) und Gruppe C erhielt die übliche Versorgung, die emotionale Unterstützung und normale Unterhaltungen umfasste.
Resultat: Gruppe A und B zeigten eine signifikant größere Reduktion bei Angstgefühl und Fatigue nach der Biopsie als Gruppe C.
Diese beklagten sogar eine Verschärfung von Fatigue nach der Biopsie. Die Meditationsgruppe zeigte zudem einen signifikant geringeren Grad an Schmerzen während der Biopsie im Vergleich zur Musikgruppe.
Wir wissen bereits, dass Meditation einen gezielten Effekt auf genetische Aktivitäten hat, Entzündungsprozesse dämpft und durch Stress induzierte Erkrankungen mildert, wie Bluthochdruck, chronische Schmerzen, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, gastrointestinale Störungen, Hautveränderungen, Depressionen, Atemwegsprobleme etc.
Fazit
Alle diese Befunde zeigen mehr als deutlich, dass die Gesundheit des Körpers keinesfalls von der geistigen Gesundheit zu trennen ist. Und umgekehrt. Beides sind die beiden Seiten der Medaille. Oder anders gesagt: Das Eine kann ohne das Andere nicht existieren. Beide bedingen sich, wie Tag und Nacht zusammen einen Tag ergeben.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Dieser Beitrag wurde am 18.4.2019 erstellt.